Die Angst, dass die sozialen Sicherungssysteme nicht mehr das halten könnten, was sie einmal versprachen, existiert nicht erst seit der Rentendebatte oder der Agenda 2010. Dass sich diese Angst aber in eine Erkenntnis gewandelt hat, das ist in der Tat eine Eigenart des 21. Jahrhunderts. Besonders die SPD hat das in den letzten Jahren zu spüren bekommen, als die ehemalige stolze Arbeiterpartei von ihren Wählern ein ums andere Mal dafür abgestraft wurde, dass sie sich mit diesen Fragen der sozialen Sicherheit nicht richtig auseinandergesetzt hatte.
Nach Martin Schulz erkennt das jetzt auch Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller. Mit seinem neuesten Vorstoß löst er eine neue Debatte aus. Es geht um das solidarische Grundeinkommen.
Was steckt dahinter?
„Wieso finanzieren wir den Ausschluss aus der Gesellschaft, anstatt uns um die Teilhabe zu bemühen? Wieso machen wir mit dem vielen in Sozialetats veranschlagten Geld aus den verwaltenden Arbeitsagenturen nicht endlich ‚Arbeit-für-alle-Agenturen‘?“, fragt Michael Müller rhetorisch. Was er meint, ist, dass Staat und Länder zu viel Geld aufwenden würden, um im Rahmen von Hartz-IV-Programmen Langzeitarbeitslosigkeit zu fördern, z.B. von Arbeitern, deren Jobs der Digitalisierung zum Opfer fallen; während sich gleichzeitig für Gemeinschaftsarbeiten kein Personal findet.
Müllers Ansatz verknüpft die beiden Aspekte. Er zielt ab auf einen zweiten Arbeitsmarkt für gemeinnützige Jobs, wie Begleitdienste, Kinderbetreuung bei Alleinerziehenden mit Nachtschicht. oder das Säubern von Parks, die jeder Hartz-IV-Empfänger gegen den Mindestlohn verrichten können soll.
Die Idee des solidarischen Grundeinkommens unterscheidet sich vom bedingungslosen Grundkommen dadurch, dass es sich im Grunde um Lohnarbeit handelt, wohingegen letzteres eben an keine Bedingungen geknüpft ist.
Wer soll das bezahlen?
Müller sieht vor, die Kosten aus den Sozialetats zu decken, also aus den Bundes- und Länderhaushalten. Auf der anderen Seite sieht er die Wirtschaft in der Pflicht. Im Tagesspiegel lässt er sich wie folgt zitieren: „Wer immer stärker spezialisierte und flexible Fachkräfte benötigt, muss sich auch maßgeblich an den Ausbildungs- und vor allem Weiterbildungskosten beteiligen.“
Finanziell steht also noch überhaupt nichts fest. Es stellt sich auch die Frage, ob das solidarische Grundeinkommen als Pauschalbetrag ausgezahlt werden soll, der mit einem fest veranschlagten Arbeitsaufwand pro Monat verbunden ist, oder auf Stundenbasis, bei der die Arbeitnehmer selbst entscheiden können, wie viel sie arbeiten können bzw. wollen.
DIW-Chef Marcel Fratzscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), befürwortet die Idee. Damit sich die Annahme von Arbeit für Hartz-IV-Empfänger lohne, müsse ein solidarisches Grundeinkommen aber bei monatlich „mindestens 1200 Euro liegen“. Bei einem Mindestlohn von 9 Euro die Stunde (Berlin) wären das nach Michael Müllers Konzept über 130 Stunden im Monat.
Wer ist dafür?
Einer der Fürsprecher ist der Linkspolitiker Gregor Gysi. Er lobt Müller für den Vorschlag und hofft, dass er damit auf eine Mehrheit im Bundesrat trifft, dessen Präsident Müller übrigens ab 1. November sein wird.
Zudem äußerte sich DGB-Chef Reiner Hoffmann positiv: „Der Denkanstoß eines solidarischen Grundeinkommens geht in die richtige Richtung, wenn damit, wie von Müller angedacht, ein sozialer Arbeitsmarkt gefördert wird.“
Auch aus der Basis gab es Beifall, so z.B. von SPD-Bundesvize Ralf Stegner: „Müller will solidarische Sicherungssysteme verbessern. Das finde ich unterstützenswert.“
Wer ist dagegen?
Das Konzept sähe ich ja gern mal genauer. Dann verstünde ich vllt auch, was daran „solidarisch“ ist, wenn das #Grundeinkommen doch wieder konditioniert (und womöglich sanktioniert?) wird… #BGE https://t.co/R4IhVNYhMR
— Anja Schillhaneck (@A_Schillhaneck) 30. Oktober 2017
Kritik kommt vor allem von der Berliner CDU. Generalsekretär Stefan Evers sagte, Müllers Idee klinge „nach einem öffentlichen Beschäftigungsprogramm zum Minimaltarif“.
Einen ähnlichen Standpunkt vertritt Michael Bohmeyer, Vorsitzender des Vereins Mein Grundeinkommen: „Ein Grundeinkommen mit Arbeitszwang, wie es Müller beschreibt, haben wir heute schon: Es nennt sich Hartz 4 und erzeugt bei den Betroffenen das Gegenteil von ,Lebenssicherheit’.“
Wer tatsächlich „mündige Bürger“ möchte, müsse „ihnen zugestehen, dass sie selbst am besten entscheiden können, wie sie ihr Leben gestalten wollen“, sagte Bohmeyer dem Tagesspiegel.
Was kann man erwarten?
Kritiker stören sich also vor allem am „Arbeitszwang“. Tatsächlich lässt sich mit so einem Vorstoß leicht polarisieren. Das zeigte schon der Berliner Kurier, der zum Thema mit folgender Bildunterschrift aufwartete: Wer in der „Industrie 4.0“ keine Arbeit mehr findet, soll Parks aufräumen. Da muss die SPD aufpassen, dass sie nicht als Ausbeuter der Arbeitslosen für staatliche Zwecke dahingestellt wird. So sollte man zum Beispiel auch über Kombinationen mit ähnlichen Konzepten aus der Vergangenheit nachdenken, wie etwa das Chancenkonto von Schulz/Nahles oder aber auch das solidarische Bürgergeld vom ehemaligen CDU-Ministerpräsidenten Dieter Althaus.
In seinem Plädoyer sprach sich Michael Müller übrigens gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen aus. In SPD-Tradition sieht er Arbeit als identitätsstiftend an. Aber: Wäre eine identitätsstiftende Arbeit nicht gerade dann möglich, wenn sie von finanziellen Zwängen befreit wäre?
Unabhängig davon wird der Bundesrat zeigen, was er von dem Vorschlag hält. Dass mit NRW, Baden-Württemberg, Bayern und Hessen gleich vier der fünf stimmreichsten Bundesländer unionsgeführt sind, könnte die Sache erschweren. Allerdings sind auch die Grünen im Bundesrat so stark wie noch nie. Sie könnten das Zünglein an der Waage sein.
Louis Koch
Neueste Artikel von Louis Koch (alle ansehen)
- Mein Minister fährt im Hühnerstall Motorrad – Lobbyismus, Kumpanei und anderer Irrsinn in der Landwirtschaft - 7. März 2018
- Warum Diesel so günstig ist und was das den Staat kostet: Das „Diesel-Privileg“ - 30. Januar 2018
- Auf ihrer ersten Pressekonferenz verlegt die neue grüne Doppelspitze Schienen für 2018 - 29. Januar 2018

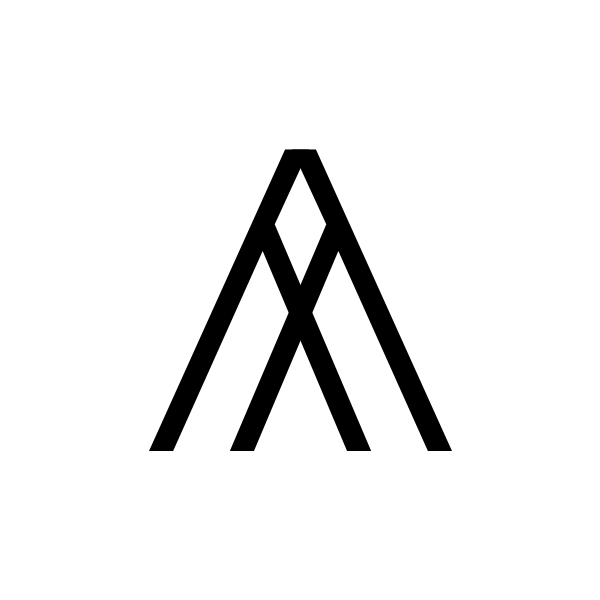






0 Kommentare
Kommentar schreiben